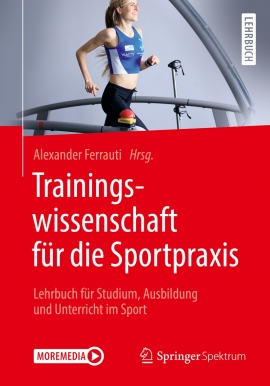
Zugeschnitten auf Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Sport - für das Modul Trainingswissenschaft
Prüfungsrelevant, außerordentlich praxisrelevant und evidenzbasiert
Reichhaltig illustriert und hochwertig didaktisch aufbereitet
Ideale Prüfungsvorbereitung für Studierende der Sportwissenschaft sowie ideal für Trainer, Auszubildende und Schüler in sport- und fitnessbezogenen Berufen
Ideal auch für die Trainerausbildung des DOSB auf B- und A-Lizenz Niveau bzw. für Diplom-Trainer
Angereichert mit Videoclips via More Media App
Dieses motivierende und reichhaltig illustrierte Lehrbuch wendet sich an Studierende im Fach Sportwissenschaft sowie an Trainer, Auszubildende und Schüler in sport- und fitnessbezogenen Berufen und dient diesen als ideale Prüfungsvorbereitung. Es ist besonders geeignet als Begleit- und Vertiefungslektüre für Vorlesungen im Fach Trainingswissenschaft.
Trainingswissenschaftliche Themen werden anschaulich, gut verständlich und praxisrelevant dargestellt. Auch interessierte Leistungs- und Freizeitsportlerinnen und -sportler erhalten eine ausgewogene Mischung von evidenzbasierten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Trainingstipps.
Wertvolle Hinweise zu den Bereichen Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung, Monitoring und Wettkampfanalyse bilden das Rückgrat des Buches. Das Grundlagenwissen zum Kraft-, Schnelligkeits-, Beweglichkeits-, Ausdauer- und Techniktraining wird durch angemessene biologische Vertiefungen und durch Exkurse zu modernen Trainingsinterventionen erweitert. Dem klaren Plädoyer für Individualisierung und Sportartspezifität des Trainings wurde durch gesonderte Kapitel zu ausgewählten Sportarten Rechnung getragen. Neben dem Leistungssport, stehen auch die Besonderheiten des Trainings mit Kindern und Jugendlichen, mit Aktiven im mittleren Lebensalter oder mit älteren Masterathletinnen und -athleten im Fokus.
Das Buch wagt den Spagat zwischen einer international ausgerichteten forschungsorientierten Trainingswissenschaft und der unweigerlich damit verknüpften Sportpraxis. Abgerundet wird das didaktische Konzept durch interaktives Zusatzmaterial in Form von Videobeispielen, die einfach mit der Springer Nature More Media App abgerufen werden können.
- Kapitel 1: Aufgaben und Inhalte der Trainingswissenschaft (3)
- Kapitel 2: Grundlagenwissen zum sportlichen Training (6)
- Kapitel 3: Leistungssteuerung (9)
- Kapitel 4: Krafttraining (6)
- Kapitel 5: Schnelligkeitstraining (6)
- Kapitel 6: Beweglichkeitstraining (6)
- Kapitel 7: Ausdauertraining (7)
- Kapitel 8: Techniktraining (11)
- Kapitel 9: Regenerationsmanagement und Ernährung (6)
- Kapitel 10: Training im Kindes- und Jugendalter (4)
- Kapitel 11: Training im mittleren und höheren Lebensalter (4)

