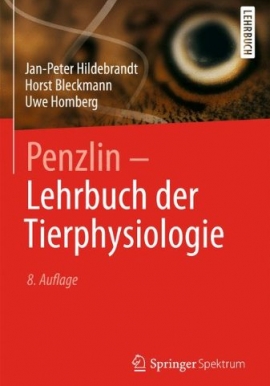Abschnitt I
Tierphysiologie und ihre physikalischen Grundlagen
Tierphysiologie ist die Lehre von den Körperfunktionen der Tiere auf allen organisatorischen Ebenen. Im Zusammenwirken mit der Morphologie (Strukturlehre) werden in der Physiologie Struktur-Funktions-Beziehungen auf dem Niveau der Moleküle (molekulare Physiologie), der Zellorganellen und Zellen (Zellphysiologie), der Gewebe und Organe (Organphysiologie), der Organismen (Systemphysiologie) wie auch deren funktioneller Bezug zu den Umweltbedingungen (Ökophysiologie) studiert. Wie in der Physik und der Chemie werden dabei die kausalen Zusammenhänge von Prozessen innerhalb der Ebenen und über diese hinweg ergründet. Außerdem ist die Physiologie bemüht, die Bedeutung von Teilfunktionen eines Organismus für die erfolgreiche Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt zu ergründen, und fragt daher immer auch nach dem Zweck eines Phänomens bzw. seiner biologischen Bedeutung (Teleonomie). Die Physiologie ist daher eine integrative Wissenschaft, die bemüht ist, durch systematischen Einsatz anerkannter und nachvollziehbarer Methoden die physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, durch die Lebewesen in der Lage sind, sich zu entwickeln, sich selbst zu erhalten und sich fortzupflanzen. Sie nutzt zur Erreichung dieses Ziels Erkenntnisse aus anderen biologischen Teilwissenschaften, der Molekularbiologie, der Genetik und der Biochemie und bedient sich ihrer Methoden. Sie umfasst daher auch moderne Wissenschaftsdisziplinen wie die Transkriptomik, die Proteomik, die Metabolomik und die funktionelle Genomik.
Chemische Ebene des Lebendigen
Die Chemie ist diejenige naturwissenschaftliche Disziplin, die Fragen der Struktur und des Verhaltens von Atomen (Elementen), der Zusammensetzung und Eigenschaften von Verbindungen sowie der Reaktionen der Substanzen und der sie begleitenden Energieumsätze verfolgt und versucht, die Gesetzmäßigkeiten in einem umfassenden System miteinander zu verbinden.
Abschnitt II
Versorgung mit Energie- und Funktionsträgern (Ernährung)
Als heterotrophe Organismen zählen die Tiere im Stoffwechselnetzwerk der Natur zu den Konsumenten. Sie ernähren sich entweder von lebenden Tieren oder Pflanzen (Biophaga) oder von bereits in Zersetzung begriffenen Pflanzen- und Tierleichen (Saprophaga). Unter den biophagen Tieren haben sich die Carnivora (Fleischfresser) auf das Fressen anderer Tiere spezialisiert. Ganze Tiergruppen wie die Turbellarien (mit Ausnahme der kleinsten Formen), Skorpione, Spinnen und Cephalopoden gehören diesem Ernährungstyp an. Sie sind generell als zoophag zu bezeichnen. Als Herbivora kennzeichnet man die Pflanzenfresser. Sie sind phytophag. Dazu gehören viele Insekten, die Nagetiere, Hasenartige, Huftiere und andere. Handelt es sich bei der Nahrung der Saprophaga um bereits in Zersetzung begriffenes pflanzliches Material, spricht man von detritophag (Mulmfresser), handelt es sich um tierische Leichen, von nekrophag (Aasfresser). Handelt es sich bei der Nahrung vornehmlich um Exkremente anderer Tiere wird dieses Verhalten als koprophag bezeichnet (Kotfresser). Saprophag ernähren sich zahlreiche Schlammfresser am Boden der Gewässer (viele Nematoden, Tubifex, Gammarus u. a. im Süßwasser, Arenicola, Sipunculus, Priapulus, viele Holothurien u. a. im Meer) sowie viele Humusbewohner (Regenwurm, Collembolen usw.).
Versorgung mit Sauerstoff (Atmung)
Die frühe Erdatmosphäre enthielt vermutlich für etwa 1,5 Mrd. Jahre nach der Erdentstehung wenig freien Sauerstoff, wie sich anhand der Oxidationsstufen des Eisens in sehr alten Sedimenten abschätzen lässt. Sie war „reduzierend“, wodurch die Entstehung von Lebewesen begünstigt worden sein dürfte, da Sauerstoff ein sehr reaktives Element ist, das abiotisch gebildete organische Substanz sehr schnell wieder zerstört hätte. Erst nach der Entstehung von prokaryotischen Organismen und der „Erfindung“ der Photosynthese durch einige dieser Organismen war es möglich, dass sich der metabolisch gebildete, molekulare Sauerstoff in der Atmosphäre anreicherte. Dies könnte für die frühen Lebewesen aufgrund der Reaktivität des Sauerstoffs eine recht bedrohliche Entwicklung gewesen sein, die, wie man heute annimmt, zur Entstehung von Schutzproteinen führte. Dazu gehören vermutlich die Vorläufer der heutigen sauerstoffbindenden Proteine und der Antioxidantien (Substanzen, die vor Oxidation schützen), die wir heute in den meisten Lebewesen finden. Obligat anaerobe Organismen sind daher auf unserer Erde inzwischen nur noch in bestimmten, dauerhaft sauerstoffarmen Rückzugsräumen (heiße Quellen, Darminhalt usw.) anzutreffen.
Zirkulation
Für die Aufnahme von Stoffen aus dem umgebenden Medium dienen Tiere besondere Körperteile. So findet die Aufnahme von Flüssigkeiten und gelösten Stoffen in bestimmten Darmabschnitten statt, die Aufnahme von Sauerstoff erfolgt in den Atmungsorganen. Da die aufgenommenen Stoffe aber nicht nur am Ort ihres Eintritts benötigt werden, muss für eine möglichst schnelle Stoffverteilung im Tierkörper gesorgt werden. Die Diffusion reicht dafür in den allermeisten Fällen nicht aus. Der von den gelösten Teilchen durch Diffusion in Richtung des Konzentrationsgefälles unter konstanten Bedingungen zurückgelegte Weg wächst mit der Quadratwurzel der Zeit. Das bedeutet, dass ein Teilchen zum Erreichen seines Ziels bei einer Verlängerung der Diffusionsstrecke um den Faktor 10 die 100-fache Zeit benötigen würde. Hinzu kommt, dass im Gewebe die Diffusionskoeffizienten der wichtigsten Stoffwechselprodukte nochmals etwa 100-mal kleiner sind als bei freier Diffusion im Wasser. Die Diffusionsverzögerung der Gase im Gewebe ist allerdings relativ klein.
Abschnitt III
Säure-Base-Regulation
Die aktuelle Balance zwischen Säuren (Protonendonatoren) und Basen (Protonenakzeptoren) in den Körperflüssigkeiten von Tieren wird als Säure-Base-Status bezeichnet. Charakterisiert wird dieser Zustand durch die Konzentration ungebundener Protonen (freie Wasserstoffionen, H+-Ionen), die in Form des negativen dekadischen Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) angegeben wird. Der pH-Wert der Körperflüssigkeiten von Tieren liegt in der Regel zwischen sechs und acht (entspricht Protonenkonzentrationen von 10−8–10−6 mol l−1). Er wird je nach Tierart und Lebenssituation in meist engen Grenzen konstantgehalten (Isohydrie). Dies gelingt durch zwei Mechanismen, pH-Pufferung und pH-Regulation. Die Pufferung des pH-Werts erfolgt durch gelöste Substanzen, die Wasserstoffionen kurzfristig anlagern oder abgeben können. Längerfristig müssen je nach Stoffwechsellage überschüssige Protonen aus den Zellen bzw. aus dem Organismus ausgeschieden oder ihre Ausscheidung vermindert werden, was durch pH-regulatorische Mechanismen an den Kompartimentgrenzen geschieht.
Osmo- und Ionenregulation
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Evolution erster Zellen in der Frühzeit der Erdgeschichte in einem Medium stattfand, das geringe Konzentrationen abiotisch gebildeter, kleiner organischer Moleküle enthielt und reich an Mineralstoffen war. Es ist daher nicht überraschend, dass die ionale Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten heute lebender Tiere in vielen Fällen Ähnlichkeiten mit der ionalen Komposition des Meerwassers erkennen lässt. Allerdings sind die Körperflüssigkeiten von Tieren nie exakt mit den jeweiligen Außenmedien identisch. Vielmehr ist die Aufrechterhaltung von Konzentrationsunterschieden (Gradienten) zwischen Körperinnerem und Außenwelt sogar ein wesentliches Merkmal lebender Systeme.
Exkretion
Alle Stoffe, die ein erwachsenes Tier aus der Umwelt durch Nahrungsaufnahme, Atmung und passive Permeation durch die Körperwand aufnimmt, werden nach kürzerer oder längerer Verweildauer entweder unverändert oder nach der Prozessierung im Stoffwechsel in Form von Derivaten oder Abbauprodukten ausgeschieden, da sie nicht weiter verwendet werden können oder gar giftig sind. Man bezeichnet diesen Prozess als Exkretion, die ausgeschiedenen Stoffe als Exkretstoffe oder Exkret.
Energiehaushalt
Der thermodynamisch unwahrscheinliche und sehr labile Zustand des Lebendigseins kann nur aufrechterhalten werden, wenn ständig Energie umgesetzt wird. Die heterotrophen Organismen – und dazu zählen alle Tiere – holen sich die Energie aus ihrer natürlichen Umgebung, indem sie dort vorhandene energiereiche Stoffe aufnehmen und in ihren Zellen zu energiearmen Stoffen umsetzen. Die bei dieser Umsetzung frei werdende Energie setzen sie ein, um ihren Zustand zu erhalten, zu wachsen, sich zu vermehren und äußere Arbeit zu leisten.
Wärmehaushalt: Adaptation und Regulation
Wärme ist eine Form von Energie. Die Wärmeenergie in einem System zeigt sich dadurch, dass die Teilchen des Systems schwingen, das heißt, sie sind permanent in Bewegung. Der Wärmegehalt eines Körpers bedingt eine bestimmte Temperatur, die in Kelvin (K; absolute Temperatur) oder in Grad Celsius (°C; relative Temperaturskala, bezogen auf den Gefrierpunkt des Wassers) gemessen wird. Je höher die Temperatur, desto intensiver sind die Schwingungen der Teilchen, aus denen das System besteht. Am absoluten Nullpunkt der Temperaturskala (0 K bzw. −273 °C) hört jede Teilchenbewegung auf, der Energiegehalt des Systems ist minimal. Bei Raumtemperatur (293 K bzw. 20 °C) enthält jeder Körper eine große Menge an Wärmeenergie, und zwar umso mehr, je größer die Masse des Körpers ist. Die thermisch bedingte Bewegung der Moleküle nach Robert Brown* (Brown’sche* Molekularbewegung) ist Voraussetzung für biologisch wichtige Prozesse, zum Beispiel die Diffusion, aber auch für chemische Reaktionen von zufällig zusammenstoßenden Atomen oder Molekülen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Reaktionsgeschwindigkeiten (bio-)chemischer Reaktionen temperaturabhängig sind.
Abschnitt IV
Information und Informationsverarbeitung
In Organismen – ebenso wie in technischen Systemen – spielen Informations-, Steuer- und Regelungsprozesse eine zentrale Rolle. Eine selbständige wissenschaftliche Disziplin, die sich – unabhängig von dem konkreten System – mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten dieser Prozesse beschäftigt, hat sich in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts unter Führung des Mathematikers Norbert Wiener* herausgebildet. Er gab ihr den Namen Kybernetik. Ihre Anwendung auf lebendige Systeme (biologische Kybernetik) hat inzwischen in vielen Fällen zu wesentlich tieferen Einsichten bis zur quantitativen Beschreibung von Zusammenhängen geführt.
Signaltransduktion
Der Begriff Signaltransduktion beschreibt alle Vorgänge, die mit dem Empfang und der Prozessierung von Information auf der zellulären Ebene zu tun haben. Viele Formen von Energie, die aus dem Extrazellularraum auf Zellen in tierischen Organismen einwirken können, haben an oder in den Zellen Änderungen der Zustände von Molekülen zur Folge, die wiederum Änderungen der Zellfunktion nach sich ziehen können. Neben vielen unspezifischen Wirkungen, zum Beispiel eine Beschleunigung der zellulären Stoffwechselprozesse durch Erwärmung einer Zelle, gibt es auch hochspezifische zelluläre Antworten auf bestimmte extrazelluläre Stimuli, die mechanischer, elektrischer, elektromagnetischer oder chemischer Natur sein können. Die Selektion der für die Zelle bedeutsamen Signale aus der Fülle an energetischen Einwirkungen und deren Prozessierung durch die Zelle wird im engeren Sinne als Signaltransduktion bezeichnet.
Neuronale Systeme
Neuronale Systeme sind eine „Errungenschaft“ der Eumetazoa. Bei ihnen stellen Nervensysteme eine unbedingte Voraussetzung für die sensomotorische und autonome Integration dar. Die Aktivität des Nervensystems bestimmt das gesamte Verhalten von relativ einfachen motorischen Programmen bis hin zu komplexen Handlungen höherer Tiere, wie Fernorientierung, Generalisierung, Begriffsbildung, Planen und Denken.
Endokrines System
In Organismen, die aus mehr als einer Zelle bestehen, müssen diese sich so abstimmen, dass Struktur und Funktion der einzelnen Zelle für die arbeitsteilige Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinn der Erhaltung und Funktion des Gesamtorganismus optimiert sind. Die interzelluläre Kommunikation kann durch direkte Zell-Zell-Kontakte erfolgen, was jedoch nur bei unmittelbar benachbarten Zellen möglich ist. Entfernt voneinander liegende Zellen kommunizieren daher entweder über neuronale Signalleitung (Fortleitung von Aktionspotenzialen, elektrische oder chemische Informationsübertragung an Synapsen) oder durch Hormone (Informationsübertragung von botenstoffproduzierenden Zellen auf Zielzellen durch chemische Botenstoffe, die mit den Körperflüssigkeiten transportiert werden). Je nach der Beziehung der hormonproduzierenden und der Zielzellen zueinander werden autokrine, parakrine und endokrine Hormonwirkungen unterschieden (◘ Abb. 14.1). Ist die botenstoffproduzierende und die empfangende Zelle identisch, spricht man von autokriner Hormonwirkung. Diffundieren die Botenstoffe über geringe Entfernungen und treffen noch im selben Gewebe auf Zielzellen, spricht man von einer parakrinen Signalübertragung. Werden die Botenstoffe mit dem Kreislaufsystem im gesamten Organismus verteilt und finden ihre Zielzellen in großer Entfernung vom Produktionsort, handelt es sich um eine endokrine Hormonwirkung.
Abschnitt V
Allgemeine Sinnesphysiologie
Tiere verfügen über Fähigkeiten, sich über bestimmte Zustände und Veränderungen in ihrer natürlichen Umgebung sowie über Eigenzustände zu informieren. Der Registrierung solcher Reize (Schall, Druck, Licht, Geruchsstoffe usw.) sowie der Weitergabe von Informationen über diese Reize in Form bioelektrischer Signalmuster an nachfolgende Zellen des Nervensystems dienen die Sinneszellen oder Rezeptoren. Ragnar Arthur Granit* nannte sie die „persönlichen Messinstrumente“ der Tiere. Extero(re)zeptoren sprechen auf Reize in der Umwelt des Tiers an, Interorezeptoren (Enterorezeptoren) informieren dagegen über Zustände und Vorgänge im Inneren des Körpers, wobei mit Enterorezeptoren oft nur die Rezeptoren der Eingeweide gemeint sind, welche den Proprio(re)zeptoren als Rezeptoren des Bewegungsapparats, wie Muskelspindeln und Sehnenspindeln, gegenübergestellt werden.
Mechanische Sinne
Mechanische Kräfte (Druck, Zug, Scherung, Torsion) wirken in vielfältiger Weise auf Tiere und den Menschen ein und übermitteln wichtige Informationen über innere (z. B. Blutdruck) und äußere (z. B. Berührung) Ereignisse und Zustände. Ionenkanäle, deren Öffnungsgrad direkt von mechanischen Reizen gesteuert wird, sind schon von Bakterien bekannt und kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen eukaryotischen Zellen vor. Sie messen die physikalischen Kräfte, die bei Volumenänderung, Dehnung, Krümmung, Streckung oder Bewegung auf die Zellen einwirken. Es verwundert deshalb nicht, dass auch einzellige Organismen mechanisch ausgelöste Verhaltensweisen zeigen (► Abschn. 16.3.2). Reaktionen auf mechanische Kräfte gehören sicherlich zu den ursprünglichsten Leistungen lebender Zellen. Obwohl das so ist, wissen wir immer noch sehr wenig über den molekularen Aufbau der Ionenkanäle, die an der Mechanotransduktion beteiligt sind. In jüngster Zeit wurden allerdings drei Klassen von Kanälen identifiziert, die hierfür infrage kommen. Es handelt sich um DEG/ENaC-Kanäle (DEG/ENaC von degenerin/epithelial Na+channels), TRP-Kanäle (TRP von transient receptor potential; ► Kap. 12) und K2p-Kanäle (Zwei-Poren-Domänen-K+-Kanäle). Darüber hinaus sind Piezoproteine (Piezo 1 und Piezo 2) wahrscheinlich ebenfalls an der Mechanotransduktion beteiligt.
Gehörsinn
„Hören“ bezeichnet die Fähigkeit, Schallwellen wahrzunehmen. Um die unterschiedlichen Funktionsweisen der im Tierreich vielfach unabhängig voneinander entstandenen Hörorgane zu verstehen, sind physikalische Grundkenntnisse notwendig. Schall bezeichnet eine Welle periodisch fortschreitender mechanischer Deformation (in Festkörpern) bzw. fortschreitender Druckunterschiede (in Gas oder Flüssigkeiten). Dabei bewegen sich die Medienpartikel (z. B. Luft- oder Wassermoleküle) in Ausbreitungsrichtung der Schallwelle und kollidieren mit benachbarten Partikeln. Sie übertragen bei der Kollision einen Teil ihres Impulses auf ihre Nachbarn und bewegen sich zurück in ihre Ruheposition. Auf diese Weise pflanzen sich Schallwellen in einem Medium fort. Da die Medienpartikel in Ausbreitungsrichtung der Welle um ihre Ruheposition schwingen, bezeichnet man Schallwellen auch als Longitudinalwellen (im Gegensatz zu Transversalwellen, in denen die Welle orthogonal zur Ausbreitungsrichtung schwingt). In einer Schallwelle wird fortwährend Kompressionsenergie in Bewegungsenergie umgewandelt und umgekehrt. Diese Energieformen können physikalisch durch die Schalldruckamplitude p (in Newton [N] pro m2 = Pascal) bzw. die Schallschnelle v (Geschwindigkeit der um ihre Ruhelage schwingenden Medienpartikel in m s−1) beschrieben werden. Schallwellen breiten sich mit einer für das Medium und dessen Zustand (z. B. Temperatur, Druck) charakteristischen konstanten Geschwindigkeit aus. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall beträgt unter Normalbedingungen in Luft 343 m s−1 und in Wasser 1484 m s−1. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Schallschnelle (► Box 17.1).
Visuelles System
Der adäquate Reiz für Lichtsinnesorgane sind elektromagnetische Wellen bestimmter Wellenlänge. Das sichtbare Licht stellt nur einen winzigen Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum elektromagnetischer Wellen dar, das von sehr kurzen γ- und Röntgenstrahlen bis zu langwelligen Radiowellen reicht (◘ Abb. 18.1). Beim Menschen erstreckt sich der sichtbare Wellenlängenbereich von 390–760 nm Wellenlänge, bei Tieren kann er weiter bis ins kurzwellige Ultraviolett (UV) oder – seltener – ins langwelligere Ultrarot (UR) reichen. Bei vielen Arthropoden ist der sichtbare Anteil des Spektrums gegenüber dem des Menschen zur kurzwelligen Seite hin verschoben, das heißt, sie nehmen noch Ultraviolett bis zu einer bestimmten Wellenlänge wahr, reagieren aber nicht auf tiefes Rot (◘ Tab. 18.1). Auch Frösche und Kröten sollen noch im ultravioletten Spektralbereich sehen können, jedenfalls schnappen sie bei reinem UV-Licht noch zielsicher ihre Beute.
Elektrischer und magnetischer Sinn
Zwischen zwei ungleich geladenen Teilchen entsteht ein elektrisches Feld, in dem eine Ladung auf die andere eine Kraft ausübt. Der Betrag dieser elektrostatischen Kraft ist proportional zum Produkt der beiden Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands der Ladungsmittelpunkte (Coulomb-Gesetz). Die elektrostatische Kraft wirkt je nach Vorzeichen der Ladungen anziehend oder abstoßend. Elektrische Felder werden durch das Vektorfeld der elektrischen Feldstärke beschrieben. Das Vektorfeld ordnet jedem Punkt im Raum einen Vektor für die Richtung und einen Betrag für die elektrische Feldstärke zu (Einheit: Volt pro Meter, V m–1). Elektrische Feldlinien laufen definitionsgemäß von Plus nach Minus. Konstanter Gleichstrom (DC-Strom; Strom ist gleich Ladung pro Zeit; Einheit: Ampere = Coulomb s–1) ist ein elektrischer Strom, dessen Stärke und Richtung sich über die Zeit nicht ändern. Wechselstrom (AC-Strom) ist ein Strom, der seine Richtung (Polung) regelmäßig wechselt und über die Zeit gemittelt null ist. Eine entsprechende Definition gilt für die Begriffe Gleichspannung und Wechselspannung. Die elektrische Leitfähigkeit (Einheit: Siemens pro Meter, S m–1) gibt die Fähigkeit eines Stoffs an, elektrischen Strom zu leiten. Den Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit nennt man elektrische Widerstand (Einheit: Ohm, Ω). Ein Ohm’scher Widerstand ist ein elektrischer Widerstand, der im Gleichstromkreis genau so groß ist wie im Wechselstromkreis. Kondensatoren haben einen kapazitiven Widerstand (jeder Kondensator setzt einem Stromfluss einen frequenzabhängigen Widerstand entgegen, bei Gleichstrom ist dieser Widerstand unendlich groß). Der elektrische Widerstand eines Kondensators (Xc) hängt von der Kapazität des Kondensators und der Frequenz der anliegenden Wechselspannung ab (Xc = 1/2 π F C, mit F = Frequenz und C = Kapazität des Kondensators). Komplexe Widerstände (z. B. Widerstände der Pflanzen- und Tiergewebe) setzen sich sowohl aus einem Ohm’schen als auch aus einem kapazitiven Widerstand zusammen.
Chemische Sinne
Vermutlich verfügen alle Tiere über Sinnesorgane, mit deren Hilfe sie chemische Substanzen in ihrer Umgebung wahrnehmen können. Reizauslösend ist ein direkter Kontakt einer solchen Substanz mit den Chemorezeptoren einer Sinneszelle. Chemorezeptoren vermitteln den Geruchs- und Geschmackssinn (◘ Tab. 20.1) und ermöglichen die subtilen Wirkungen von Pheromonen. Die wichtigste Aufgabe des Geschmackssinns ist die chemische Prüfung potenzieller Nahrung. Geschmackssinneszellen kommen deshalb vornehmlich im Bereich des Munds (viele Wirbellose), an den Mundgliedmaßen (Insekten, Spinnentiere, Krebse), an den Tarsen (Insekten) und in der Mundhöhle (Wirbeltiere) vor. Bei vielen Fischen (insbesondere bei den Cypriniden und Siluriden) sind Geschmacksrezeptoren zusätzlich auf der gesamten Körperoberfläche verteilt. Adäquate Reize für den Geruchssinn sind flüchtige (Landtiere) und gelöste Stoffe (aquatische Tiere), die sich auch bei fehlenden Luft- und Wasserbewegungen durch Diffusion ausbreiten. Bei reiner Diffusion benötigen an einem Ort freigesetzte 6 × 1017 Moleküle (1 μmol) allerdings 10 min, um 1 cm im Wasser bzw. 1 m in Luft zurückzulegen. Wichtig für die schnelle Ausbreitung von Duftstoffmolekülen sind deshalb Luft- oder Wasserströmungen (Konvektion). Nur in diesem Fall können auch weit entfernte Reizquellen zeitnah wahrgenommen und lokalisiert werden (Witterungsvermögen). Im Gegensatz zum Sehen funktioniert der Geruchssinn auch bei Dunkelheit und bei verdeckten Reizquellen. Zudem verraten Duftstoffmoleküle vielen Tieren auch noch nach Stunden oder Tagen, wer sich wann wo aufgehalten hat. Allgemein kommt dem Geruchssinn bei der Nahrungssuche, beim Auffinden von Geschlechtspartnern, beim Erkennen von Feinden und Artgenossen, bei der Verwandtschaftserkennung und bei der räumlichen Orientierung eine große Bedeutung zu. Die zum Wahrnehmen von Duftstoffen notwendigen Riechsinneszellen befinden sich unter anderem auf den Antennen der Insekten, in mit der Umgebungsluft in Kontakt stehenden Hohlräumen des Vorderkopfs (landlebende Wirbeltiere) und in den Nasengruben der Fische. Bei aquatischen Tieren ist eine Unterscheidung zwischen Geschmacks- und Geruchssinn im Verhaltensexperiment schwierig, da nicht nur die Riechsinneszellen, sondern auch die Geschmackssinneszellen auf im Wasser gelöste Substanzen (z. B. Aminosäuren) reagieren.
Thermischer Sinn und Infrarotsinn
Die Temperatur ist eine physikalische Größe. Für feste, flüssige und gasförmige Stoffe gilt: Je höher die Temperatur eines Körpers, desto größer ist die mittlere Geschwindigkeit seiner Teilchen (am absoluten Nullpunkt von −273 °C beträgt die Teilchengeschwindigkeit null). Wärmeleitung (auch Wärmediffusion oder Konduktion) ist der Wärmefluss in einem Feststoff oder einem ruhenden Fluid (Flüssigkeit oder Gas) infolge eines Temperaturunterschieds. Wärme fließt dabei – gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik – immer in Richtung der geringeren Temperatur. Ein Maß für die Wärmeleitung eines Stoffes ist seine Wärmeleitfähigkeit. Konvektion ist ein Wärmetransportmechanismus. Konvektive Vorgänge sind bedingt durch die Bewegung von frei beweglichen Teilchen relativ zu angrenzenden Körpern. Trifft zum Beispiel ein warmer Luftstrom auf einen Gegenstand mit niedrigerer Temperatur, wird dieser erwärmt (konvektive Wärmeübertragung). Wärmestrahlung oder thermische Strahlung ist elektromagnetische Strahlung, die jeder Körper, dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt liegt, aufgrund seiner Temperatur aussendet. Im Gegensatz zu Konvektion und Konduktion durchdringt Wärmestrahlung auch den luftleeren Raum. Trifft Wärmestrahlung auf einen Körper, wird sie entweder transmittiert (durchgelassen), reflektiert oder absorbiert. Bei der Absorption wird Strahlung vom Körper aufgenommen und in Wärme umgewandelt.
Nozizeption und Schmerz
Alle tierischen Lebewesen verfügen vermutlich über die Fähigkeit, aversive, gewebeschädigende Reize zu detektieren und hierauf effektiv zu reagieren. Abwehr- und Vermeidungsverhalten gegenüber schädlichen, noxischen, Reizen findet man bereits bei Cnidariern. Ein eigenständiges nozizeptives Sinnessystem (Nozizeption) wurde erstmals 1903 von Charles Sherrington* vermutet und ist inzwischen vor allem bei Säugetieren intensiv untersucht, bei anderen Wirbeltieren, Insekten, Mollusken und dem Nematoden Caenorhabditis elegans aber ebenfalls bestätigt.
Abschnitt VI
Produktion mechanischer Energie
Im Gegensatz zu den höheren Pflanzen sind die meisten Tiere nicht sessil, sondern zeigen ein komplexes motorisches Verhalten. Dazu gehören die Lokomotion (Schwimmen, Laufen, Fliegen) ebenso wie die spezifische Körperhaltung, die Nahrungsaufnahme und -verarbeitung, die Atemmechanik und die Schallproduktion, um nur einige Beispiele zu nennen. In vielen Fällen liegen diesen Verhaltensweisen zumindest teilweise genetisch fixierte motorische Programme zugrunde.
Produktion akustischer Signale
Als Schall werden longitudinale Schwingungen von Teilchen in elastischen Medien wie Luft und Wasser, aber auch in festen Substraten wie Holz oder Gestein bezeichnet (◘ Abb. 24.1). Um Schall zu erzeugen, müssen Tiere durch Muskelkraft Körperteile oder Gegenstände (Schallquellen) in Schwingungen oder Vibrationen versetzen, welche zur Ausbreitung an das umgebende Medium (Luft, Wasser oder festes Substrat) übertragen werden. Für die akustische Kommunikation sind demnach Schallerzeugung, Schallkopplung und Schallausbreitung wichtige Parameter (◘ Abb. 24.2).
Produktion elektrischer Energie (elektrische Organe)
Einige Elasmobranchier sowie viele Knochenfische erzeugen mithilfe von elektrischen Organen verschiedenartige elektrische Signale. Diese Signale werden entweder kontinuierlich abgegeben (Wellenentlader, Frequenz 50–1700 Hz) oder sie bestehen aus einzelnen, kurzen Impulsen (Pulsentlader, Pulsdauer 0,1–8 ms, bei stark elektrischen Fischen bis 200 ms) die in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen (Wiederholrate 1–200 Hz) erzeugt werden. Elektrische Organentladungen können sich in ihrer Dauer, Form, Polarität und spektralen Zusammensetzung unterscheiden (◘ Abb. 25.1). Sowohl Entladungsfrequenz als auch Pulsform können art-, alters- und geschlechtsspezifisch sein. Dabei wird die Pulsform durch den Feinbau der elektrischen Organe, die Pulswiederholungsrate durch die Aktivität zentraler Schrittmacherneurone bestimmt. Die Pulsform hängt darüber hinaus auch von der Wassertemperatur und der Leitfähigkeit des Wassers ab. Schrittmacherneurone entscheiden darüber, ob ein Fisch ein Wellenentlader (Pulsintervall ≤ Pulsdauer) oder ein Pulsentlader (Pulsintervall > Pulsdauer) ist. Schon in der Antike war bekannt, dass manche Fische bei Berührung schockartige Empfindungen auslösen. Diese Fische, zu denen die Malapteruridae (afrikanischer Zitterwels, Malapterurus), die Torpedinidae (Zitterrochen Torpedo), die Uranoscopidae (Sterngucker, Astroscopus) und die Electrophoridae (Zitteraale) gehören (◘ Abb. 25.1), werden als stark elektrische Fische bezeichnet und geben zur Feindabwehr, aber auch zum Betäuben oder Töten ihrer Beute, elektrische Entladungen (Dauer 1–200 ms) mit hoher Stromstärke oder hoher Spannung ab. Dabei bestimmt die Leitfähigkeit des Wassers im natürlichen Lebensraum, ob eine Art Stromstöße hoher Spannungen oder hoher Stromstärke generiert, denn im Süßwasser lassen sich aufgrund der geringen Leitfähigkeit zwar leicht hohe Spannungen, aber nur schwer hohe Stromstärken erzeugen. Vermutlich aus diesem Grund generieren die im Süßwasser lebenden Zitteraale (Electrophorus electricus, Länge bis zu 2,5 m, Gewicht bis über 20 kg) elektrische Signale, die eine Stromstärke von weniger als 1 A aufweisen, aber eine Spannung von bis zu 800 V haben. Im Meerwasser sind die Verhältnisse umgekehrt: Dort lassen sich wegen der großen Leitfähigkeit des Mediums nur schwer Signale mit hohen Spannungsamplituden erzeugen. Demzufolge generieren marine Zitterrochen (Torpedo, Länge bis zu 1,2 m, Gewicht bis zu 40 kg) Signale, die eine Spannung von nur 50 V, aber eine Stromstärke von bis zu 50 A haben. Elektrische Pulse dieser Stärke sind auch für den Menschen gefährlich.
Produktion von Licht (Biolumineszenz)
Lumineszenz und Fluoreszenz sind Begriffe, mit denen die Eigenschaften von Systemen beschrieben werden, die unter bestimmten Umständen im sichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums liegende Strahlung aussenden. Die Anregung der Systeme zur Emission von Licht kann entweder im Zuge chemischer Reaktionen entstehen (Lumineszenz) oder durch Anregung durch energiereichere Strahlung. Im zweiten Fall wird das Licht (Fluoreszenzlicht) erst während des Übergangs des angeregten Moleküls in den Grundzustand abgegeben. Mit dem Begriff Biolumineszenz beschreibt man die Erscheinung, dass Lebewesen sichtbares Licht erzeugen. Die Lichtemission erfolgt teilweise mit sehr hoher Intensität. Sie ist mit einer sehr geringen Wärmeentwicklung verbunden („kaltes Licht“). Lumineszenz kann bei Tieren auch mit Fluoreszenz gekoppelt auftreten.
Farbwechsel
Die Fähigkeit zum Farbwechsel unter dem Einfluss endogener oder exogener Reize ist bei wechselwarmen Tieren (z. B. Insekten, Krebse, Tintenfische, Fische, Frösche, Eidechsen, Chamäleons, Schlangen) weit verbreitet. Ausführlich beschrieben wird der Farbwechsel erstmals am Beispiel der Cephalopoden von Aristoteles*. Der Farbwechsel der Tiere hat drei Funktionen:
Produktion von Giften und Abwehrstoffen
Giftige oder übel riechende oder schmeckende Tiere kommen in sehr vielen Taxa des Tierreichs vor. Die von ihnen produzierten oder von anderen Organismen übernommenen Gift- (Toxine) oder Abwehrstoffe gehören den verschiedensten Stoffklassen an (◘ Tab. 28.1). Einzelne Giftstoffe sind in ihrer Wirkung oft sehr spezifisch, sodass sie in der neuro- und zellbiologischen Grundlagenforschung, in besonderen Fällen sogar in der Medizin zur Anwendung kommen, um bestimmte Prozesse in Zellen, Geweben oder menschlichen Patienten selektiv zu blockieren. Selten kommen die Gift- und Abwehrstoffe im giftigen Tier jedoch in reiner Form vor. In fast allen Fällen enthalten die Sekretionsprodukte Mischungen aus verschiedenen Giftstoffen, die so zusammengesetzt sind, dass die Gesamtheit aller Wirkstoffe dem Tier den optimalen Nutzen aus dem Einsatz des Giftcocktails sichert. Daraus ergibt sich, dass das Studium von Struktur und Wirkung tierischer Gifte und Abwehrstoffe sehr gute Einblicke in coevolutive Zusammenhänge geben kann. Der evolutive Wettlauf um den größtmöglichen Effekt eines Stoffs bei möglichst geringem Materialeinsatz hat zur Bildung von tierischen Gift- und Abwehrstoffen geführt, deren Wirkung schon in extrem niedriger Konzentration eintritt.
Immunsysteme
Die ersten eukaryotischen Zellen, die die Erde bevölkerten, dürften sich energiereiche organische Moleküle in der Regel durch die endocytotische Aufnahme und intrazelluläre Verdauung von Bakterien verschafft haben. Sie lebten daher mit einiger Sicherheit in enger räumlicher Assoziation mit Bakteriengesellschaften, die zum Beispiel in Form von Biofilmen aus Prokaryoten unterschiedlichster Stämme bestanden. Es ist anzunehmen, dass es unter diesen bereits Formen gab, die versucht haben, durch die Schädigung oder das Abtöten eukaryotischer Zellen einerseits zu verhindern, selbst gefressen zu werden, und sich andererseits das organische Material der eukaryotischen Zellen für die eigene Ernährung zunutze zu machen. Daher ist es nicht überraschend, dass die eukaryotischen Zellen chemische Strategien entwickelten, die Aktivität von Mikroorganismen in ihrer Umgebung so zu beeinträchtigen, dass diese keine Schäden an den eukaryotischen Zellen anrichten konnten.